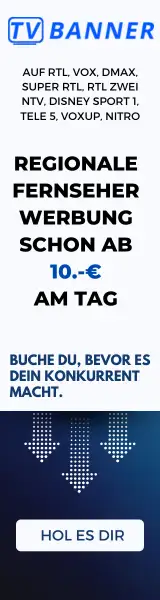Autoreifen und deren Geschichte
 Der Reifen und seine Entstehungsgeschichte
Der Reifen und seine Entstehungsgeschichte
Der Reifen stellt in der Einheit des Rades den äußeren Umfang und die Lauffläche dar, welche den Kontakt zwischen Fahrzeug und Straße erst möglich macht.
Am Anfang war das Rad
Am Anfang war ein Rad, und zwar ein Rad ohne Reifen, zuerst aus Holz und später aus Metall. Mit dieser holprigen und unbequemen Lösung war 1889 Schluss. Der Gummireifen, luftgefüllt und stoß absorbierend wurde erstmalig patentiert. Der französische Reifenhersteller Michelin hatte das Rennen um den ersten luftgefüllten Autoreifen gewonnen.
Dann wurde es interessant auf dem Reifenmarkt
Die Vulkanisiertechnik, bereits 1844 von Charles Goodyear erfunden und patentiert, nahm eine rasante Entwicklung und schon bald wurden Reifenmischungen und Formen entwickelt, die dem Reifenaufbau unserer Zeit bereits sehr nahekamen. Continental brachte 1904 den ersten Profilreifen auf den Markt. Nun ging es an die Erforschung von Profiltypen, die im Wechsel der Jahreszeiten, Sommer und Winter, ihre temporären Profilvorteile ausspielten. Die Unterscheidung zwischen Sommerreifen und Winterreifen belebte den Reifenmarkt und Entwickler kreierten Gummimischungen, die aufgrund ihrer Zutaten die Reifen haltbarer und flexibler machten. Es wurde Wert auf Fahrkomfort, Kraftstoffverbrauch und temperaturabhängige Materialveränderung gelegt.
Heute ist alles einfacher
Reifenkäufer mussten noch bis zum 1. November 2012 ihre Sommerreifen oder Winterreifen nach den uneinheitlichen, teils blumigen Angaben verschiedener Reifenhersteller aussuchen. Doch ab November 2012 griff eine EU-Verordnung. Alle europäischen Reifenhersteller haben ab dem Stichtag ihre Angebote mit einem Label zu versehen, das einheitliche Angaben über Rollwiderstand, Nasshaftung und Geräuschemission enthält. Leider enthalten die Label-Pflichtangaben keine Werte über die ebenfalls sehr wichtigen Faktoren, nach denen der Käufer seinen Reifen aussucht, wie:
- Trockenhaftung
- Aquaplaning verhalten
- Fahrstabilität, Kurvenverhalten
- Präzision der Lenkung
- Lebensdauer, harte oder weiche Gummimischung
- Bremseigenschaften, homogener Kontakt zur Fahrbahn
- Verhalten bei winterlichen Bedingungen (bleibt das Material auch bei tiefen Temperaturen weich?)
Fazit:
Der Autoreifen hat in den letzten 100 Jahren eine rasante Entwicklung gemacht. Trotz des aktuell sehr hohen Reifenstandards in Bezug auf Reifenaufbau, der Selektion nach Winterreifen und Sommerreifen sowie den Gummimischungen für jede Gelegenheit, wird der Reifenmarkt auch in Zukunft Überraschungen für uns bereithalten. Alles dreht sich um die handtellergroße Reifenaufstandsfläche, nur hier wird entschieden, wie viele Kräfte übertragen oder abgebaut werden können. Hier schließt sich der Kreis, denn das war immer so und wird sich auch nicht ändern.